Gerne stelle ich eine beeindruckende Geschichte aus dem Buch von Johanna Wagner „Zwischen den Zeilen reisen“ hier auf meinem BLOG vor. Ich wünsche allen viel Freude und Erkenntnis beim Lesen – Ralf Hillmann
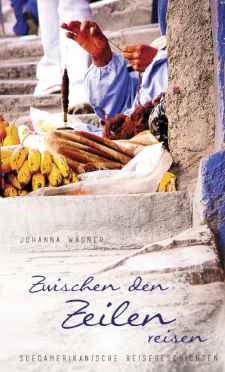 Ein Dienstag am Montag
Ein Dienstag am Montag
von Johanna Wagner: Ich besuche Alex. Jeden Dienstag fuhr ich mit dem Fahrrad zu ihm. Jeden Dienstag lag er im Bett. Sechs Monate lang und auch heute. Obwohl Montag ist. Damals sagte er, dass die Wochentage für ihn bedeutungslos seien. Ein Tag sei wie jeder andere, nur der Dienstag sei seit meinen Besuchen stets ein besonderer Tag für ihn gewesen. Dass ich an einem Tag der Woche Zeit an seinem Bett verbrachte, verlieh seinem Leben einen Rhythmus. Heute bringe ich den Rhythmus aus dem Takt, besuche ihn an einem Montag, in der Hoffnung, er könne so werden, wie es einst die Dienstage waren. Als ich den steilen Berg unter der noch immer warmen Sonne hochstrample und das kleine, noch immer unverputzte Haus am Ende der Straße erkenne, fühle ich mich wie an jenen Dienstagen. Alles ist wie immer, der einzige Unterschied: Heute weiß Alex nichts von meinem Besuch. Heute würde er niemals ahnen, dass uns in diesem Augenblick nur wenige Meter voneinander trennen. Denn zwischen meinem letzten und dem heutigen Besuch liegen nicht sieben Tage, sondern vier Jahre und drei Monate. Ich lehne mein Fahrrad an die Stelle der unverputzten Hauswand, an der ich es immer abstellte, gehe mit einem aufgeregten Herz langsam die Rollstuhlrampe hoch, schaue wortlos um die Ecke und blicke in sein unverändertes Gesicht, das sich in diesem Augenblick zur Türe dreht und mich ansieht. Nie zuvor habe ich ein überraschteres Antlitz gesehen, in dem sich die Emotionen derart überschlagen und der Körper doch nur still im Bett verharren kann. Freude, Zweifel, Glück und gleichzeitig werden Tränen mit den Fäusten aus den Augen gewischt. Ich könnte mitweinen. Mir ist gerade alles zu viel! In wenigen Sekunden holt die Gegenwart die vier vergangenen Jahre ein. Die Gegenwart freut sich, die Gegenwart weint. Sie schmerzt und drückt mit aller Kraft und ihrer großen Fülle an derzeitigen Emotionen zu. Meine Zeit läuft ab und schließlich laufen mir auch Tränen über die Wangen, noch ehe ich den Raum betreten habe. Alex ist vor sieben Jahren kopfüber in einen zu flachen See gesprungen. Er war 21. Nach einer festen Umarmung sagt er, dass mein Besuch das Schönste sei, was ihm in diesem Jahr widerfahren ist und spricht damit aus, was ich nicht hören wollte und doch auch unausgesprochen wusste. Mit ihm kann man über Gott und die Welt philosophieren, reflektieren, die Kontinente vergleichen und dadurch seine Menschen verstehen, das eigene Portugiesisch verbessern und einfach nur zusammen lachen. Damals wie heute. Nur damals unbefangener. Seine Augen strahlen, seinen Augen weinen. Und während unseres Gesprächs, während unseres Lachens, das sich in den Jahren nicht fremd geworden ist, kann auch ich nicht länger zurückhalten, was sich seit Tagen in mir aufstaut: Ich weine nicht nur ein paar Tränen – ich weine bitterlich. Ich kann nicht anders. Keine Worte in mir, keine Gedanken in mir, obwohl es immer die Gespräche waren, die unsere gemeinsamen Stunden so kurzweilig sein ließen. Heute gelingt es nur meinen Tränen, diesem gegenwärtig so gewaltigen Gefühlsgewirr Ausdruck zu verleihen. Da sitze ich nach sechseinhalb Monaten auf dem südamerikanischen Kontinent, nach glücklichen und abwechslungsreichen vier Jahren, in diesem einfachen Zimmer dieses einfachen Hauses, am Ende der schlichten Straße kleiner Häuser, am Rande einer armen Stadt gelegen und blicke einem Menschen ins Gesicht, dessen Augen nach einer Freiheit verlangen, die der eigene Körper verwehrt. Während mir so viele Türen offenstehen, kennt er nur die eine, durch die er nicht einmal hindurchschreiten kann. Ich verstehe das Leben nicht. Weder mein eigenes, in dem sich in diesen Stunden mein Traum verabschiedet noch seines, dessen Leben nicht mehr hoffnungsvoll träumen darf. Ich schäme mich. Und weine wortlos, weil ich diese Gedanken nicht laut aussprechen möchte. Weine, obwohl mir das Leben Grund zur Freude gibt. Und der, der weinen dürfte, tröstet mich mit Worten. Verwirrung und Melancholie, Dankbarkeit und Glück beziehen den kleinen Raum meines Herzens. Es ist eine merkwürdige Wohngemeinschaft, die eskaliert. Ein Gemisch, das explodieren muss. Erst recht, wenn das Gefühlschaos zu vergleichen, zu denken beginnt. Ich berichte ihm von den zurückliegenden Jahren in Deutschland und von meiner Reise durch einen Teil Südamerikas. Er hört aufmerksam zu und stellt viele Fragen, während ich mich fast nicht zu fragen traue, wie seine Jahre waren. Er lag im Bett, er liegt im Bett. Seit dem Tag, an dem ich ging, bis zum heutigen Tag, an dem ich wiederkehrte. Sein Leben findet innerhalb dieser Wände statt. Sein Blick wird vom Leben nicht belebt. Gedanken kreisen im wachen Kopf. Die weiße Wanduhr tickt im immer gleichen Takt. Er liegt, als hätte er sich vier Jahre lang nicht bewegt, ruht unverrückt, wie das Mobiliar seines Zimmers. Sogar das Foto, welches ich ihm zum Abschied schenkte, hängt noch immer dort an der Wand, wo ich es vor vier Jahren für ihn aufhängte. Es ist ein wenig verblasst und verbildlicht die Erinnerung, die in meinem Herzen wohnt: Ein wenig verblasst, doch unverrückt. Alex erzählt, dass regelmäßig Freunde vorbeikommen und ihn im Rollstuhl mit auf die Straße nehmen. Dass er angefangen hat, Deutsch und Englisch zu lernen und dass er immer noch gerne Radio hört und fernsieht. Er wirkt zufrieden, als habe er sein Schicksal akzeptiert – das bewundere ich! Er sagt, dass er oft an mich gedacht hat und ich denke, dass ich viel zu selten an ihn gedacht habe. Viel zu selten für gute Gespräche, die wir führten. Viel zu wenig, für einen Menschen, mit dem ich aufrichtig lachte und dessen Lebensfreude nicht zu seiner Geschichte passt. Aus dem kleinen Fernseher ertönt die Stimme des Fußballmoderators: Brasilien führt mit zwei zu null gegen Chile. Vermutlich sind wir die einzigen in diesem fußballverrückten Land, die die Tore erst in der Wiederholung sehen. Die Halbzeit des Spiels ist unser Schlusspfiff. Fremdgesteuert gehe ich die Rollstuhlrampe herab, ergreife geistesabwesend mein Fahrrad, vernehme die Stimme von Alex, der mir noch einige Worte durch das offene Fenster hinterherruft, die ich nicht mehr richtig verstehe und rolle schließlich den Berg herunter. Die Wiese und die Häuser, die meine Hinfahrt bereits bunt anmalte, erscheinen in diesem Augenblick wieder in grau. Sie sind wie ein verblasstes Foto, das seit vier Jahren an der Wand hängt. Das war ein trauriger Besuch mit zu wenig Zeit. In meinen Gedanken ziehen Wochen und Jahre mit leeren Dienstagen vorbei. Ich übersehe die Welt und verursache beinahe einen Unfall, als mich das Hupen einiger Autos aus meinen Gedanken reißt. Wie viel sinnvoller ich mein Leben doch leben könnte! Wie viel mehr ich alles empfinden müsste! Das Leben hat uns Sinne geschenkt, doch wir hüllen uns in Watte, damit wir uns nirgends stoßen und nirgends anstoßen. Wir gehen mit einem Blindenstock durchs Leben, obwohl wir nicht blind sind. Wir berauben uns des Besten im Leben und beklagen, wie fad es ist – doch so war das alles nicht gedacht! 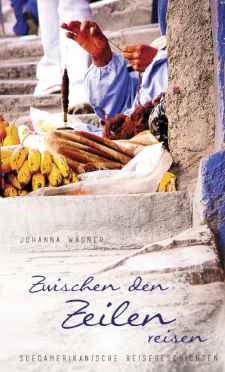 Wir sollten uns an den Ecken des Lebens stoßen, an den Kanten aufreiben, in die Furchen stürzen, ins Dunkel laufen und von Hellem nicht blenden lassen. Uns die Zunge verbrennen, frieren, schwitzen, schreien, schweigen, lachen, weinen. Das Salz auf den Lippen schmecken, die Luft in die Lungen spülen und wandern, bis die Füße schmerzen. Unsere Sinne gebrauchen und das Leben im Heute aufführen. Denn das Leben ist viel mehr, als das Abhaken nie endender To-Do-Listen, mehr als das schnelle Vorwärtskommen, das keine Pausen kennt und mehr als das Streben nach Profit, mit welchem wir ein Leben führen sollen, das von Konzernen gelenkt, zum Konsumieren verpflichtet. Befindet sich das wahre Leben nicht genau im Gegenteil? Verbirgt es sich nicht in der Einfachheit, in der Langsamkeit? Mitten im turbulenten Alltag vergisst man das manchmal. Unsere Tage sind von Beginn an gezählt, doch manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit so hoher Geschwindigkeit durch die vielen rasen, die es ausmachen, dass wir erst an dem letzten bemerken, wie wertvoll ein einzelner ist. Wir sollten endlich aufhören, niveaulos auf hohem Niveau zu jammern und endlich anfangen, das Leben zu leben und alles zu genießen: Jede Bewegung und jede Empfindung. Jede Möglichkeit und jede Schranke. Jedes Fallen und jedes Dagegen-Laufen. Einfach alles. So lange es geht. So lange wir können. Denn manche können es nicht!
Wir sollten uns an den Ecken des Lebens stoßen, an den Kanten aufreiben, in die Furchen stürzen, ins Dunkel laufen und von Hellem nicht blenden lassen. Uns die Zunge verbrennen, frieren, schwitzen, schreien, schweigen, lachen, weinen. Das Salz auf den Lippen schmecken, die Luft in die Lungen spülen und wandern, bis die Füße schmerzen. Unsere Sinne gebrauchen und das Leben im Heute aufführen. Denn das Leben ist viel mehr, als das Abhaken nie endender To-Do-Listen, mehr als das schnelle Vorwärtskommen, das keine Pausen kennt und mehr als das Streben nach Profit, mit welchem wir ein Leben führen sollen, das von Konzernen gelenkt, zum Konsumieren verpflichtet. Befindet sich das wahre Leben nicht genau im Gegenteil? Verbirgt es sich nicht in der Einfachheit, in der Langsamkeit? Mitten im turbulenten Alltag vergisst man das manchmal. Unsere Tage sind von Beginn an gezählt, doch manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit so hoher Geschwindigkeit durch die vielen rasen, die es ausmachen, dass wir erst an dem letzten bemerken, wie wertvoll ein einzelner ist. Wir sollten endlich aufhören, niveaulos auf hohem Niveau zu jammern und endlich anfangen, das Leben zu leben und alles zu genießen: Jede Bewegung und jede Empfindung. Jede Möglichkeit und jede Schranke. Jedes Fallen und jedes Dagegen-Laufen. Einfach alles. So lange es geht. So lange wir können. Denn manche können es nicht!
Mehr zum Buch und über Johanna Wagner: hier klicken





















